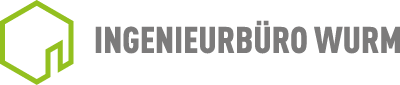Ökonomische Nachhaltigkeit: Strategie für Unternehmen
Unternehmen müssen sich rüsten: Die EU-Taxonomie und ESG-Vorschriften machen eine Nachhaltigkeitsstrategie unvermeidbar. Wie geht das?
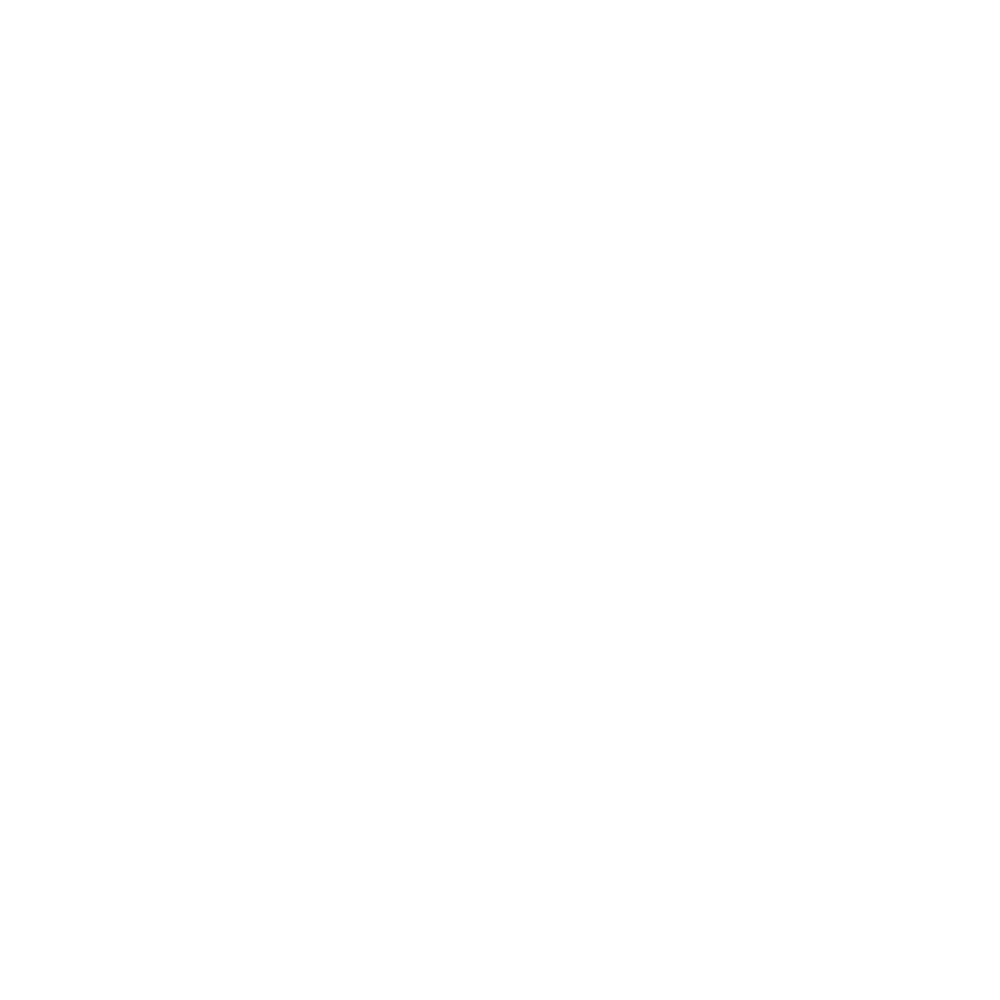
Nachhaltiges Wirtschaften erfordert eine Nachhaltigkeitsstrategie
Viele Unternehmen in Deutschland und weltweit befinden sich aktuell im Zugzwang. Sie stehen vor der Herausforderung, den Klimawandel einzudämmen, zumindest aber die globale Erderwärmung auf unter 2 Grad Celsius „im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter“ einzuschränken – das ist das Ziel des Pariser Klimaabkommens von 2015. Um das zu schaffen, muss die sogenannte „Treibhausgas-Neutralität“ in Deutschland bis 2045 erreicht werden : Es dürfen nicht mehr schädliche Treibhausgase ausgestoßen werden, als die Wälder der Atmosphäre entziehen können. Zur Abmilderung des Klimawandels müssen insbesondere Finanzströme nachhaltig umgeleitet werden. Aktuell reicht die Höhe der Finanzströme, die in den Klimaschutz fließen, noch nicht aus.
Um das Ziel der Treibhausgasneutralität zu erreichen, beschloss die Europäische Union 2019 den Green Deal: Bis 2030 müssen die Treibhausgasemissionen um 65 Prozent gegenüber 1990 reduziert werden, bis 2050 soll Europa der erste klimaneutrale Kontinent sein. Ein zentraler Bestandteil des Plans ist ein einheitliches Klassifizierungssystem für ein nachhaltiges Finanzwesen, die sogenannte EU-Taxonomie. Sie definiert, was nachhaltiges Wirtschaften für Unternehmen bedeutet und welche Bedingungen dafür erfüllt sein müssen. Im Fokus stehen dabei zunächst Aktivitäten, die auf die sechs in der Taxonomie vereinbarten Umweltziele einzahlen. Wenn ein Unternehmen mit seinen Aktivitäten beispielsweise einen wesentlichen Beitrag zu einem der Umweltziele (derzeit Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel) leistet,
- einen wesentlichen Beitrag zu einem der Umweltziele (derzeit Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel) leistet,
- dabei keines der anderen Umweltziele beeinträchtigt (wie Kreislaufwirtschaft und Biodiversität),
- zusätzlich Mindeststandards für Arbeits- und Menschenrechte einhält
- und spezifische technische Bewertungskriterien erfüllt, dann entsprechen seine Aktivitäten der EU-Taxonomie.
Um sicherzustellen, dass Unternehmen diesen Vorgaben Folge leisten, müssen sie viele Informationen über ihr Handeln offenlegen. Das Ziel: Investoren und Investorinnen können so direkt erkennen, wie nachhaltig ein Unternehmen ist und nachhaltig investieren. Auch Banken – wie die BayernLB – müssen offenlegen, wie viel Prozent ihrer Finanzierungen konform zur EU-Taxonomie sind.
Momentan betrifft die Regulierung nur große und kapitalmarktorientierte Unternehmen, die dem CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz unterliegen. Doch das wird sich bald ändern. Patricia Posch, Expertin für strategische Nachhaltigkeit bei der BayernLB, bemerkt den Wandel bei ihrer täglichen Arbeit: „Seit dem Pariser Klimaabkommen ist Nachhaltigkeit für Unternehmen kein Nice-to-Have mehr, sondern wird zunehmend zum Must-have. Das wird regulatorisch durch die Gesetzgebung forciert. Es gibt nach der neuen Corporate Sustainability Reporting Directive (kurz CSRD) ab dem Geschäftsjahr 2024 auch für mittelständische Unternehmen eine Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das stellt den Mittelstand vor große Herausforderungen, denn viele Unternehmen beginnen erst damit, sich mit Nachhaltigkeit und den Auswirkungen auf ihr Geschäftsmodell auseinanderzusetzen.”
Wie wird die strategische Basis für Nachhaltigkeit im Unternehmen gelegt?
Weil das Thema so wichtig für die BayernLB ist, hat sie eine eigene Stabseinheit für das Thema Nachhaltigkeit eingerichtet, zu der auch Patricia Posch gehört. Geleitet wird die Einheit von Franz Dohnal. Er ist verantwortlich bei der BayernLB für Compliance und Nachhaltigkeit. Wichtig ist dem Chief Sustainability Officer, dass Nachhaltigkeit nicht nur als Compliance-Übung verstanden wird: „Das Wichtigste bei der Nachhaltigkeit ist, auch die Chancen am Markt zu sehen. Durch die Veränderungen in der Regulatorik wird der Markt aufgerüttelt.
Wir haben die beiden befragt: Was müssen Unternehmerinnen und Unternehmer heute wissen, um nachhaltig zu werden – und den strengen Standards der EU-Taxonomie zu entsprechen? Und wie schaffen sie es, zukünftig über ihre Nachhaltigkeit zu berichten – das schreibt nämlich die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) künftig vor.
1. Die Analyse
„Als erstes macht man eine Analyse”, meint Franz Dohnal. Um klimarelevante Chancen und Risiken zu betrachten, sollten Sie zwei Perspektiven einnehmen: die Inside-out-Perspektive und die Outside-in-Perspektive.
Bei der Inside-out-Perspektive „muss man überlegen, was stellt das Thema Nachhaltigkeit mit mir an, was kommt von meinem Umfeld oder von meiner Umwelt auf mich zu? Dabei geht es um Risiken, aber natürlich auch um zusätzliche Chancen,” so Franz Dohnal.
Die Outside-in-Perspektive bezeichnet die Analyse der Chancen und Risiken, die sich durch den Klimawandel und die Aktivitäten zum Klimaschutz für das eigene Unternehmen ergeben:
„Ich muss überlegen, welchen Beitrag leiste ich – im Positiven wie im Negativen. Also beispielsweise: Welche Umweltbelastungen verursache ich? Aber auch: Welche Produkte kann ich herstellen, um das zu verbessern?
Das ist der erste Schritt, um eine sogenannte Wesentlichkeitsanalyse zu erstellen. Analysieren Sie genau Ihren Impact und Ihr Risiko.
2. Der Bericht
Ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung sollte klar und transparent sein. Für viele Unternehmen ist Unterstützung in diesem Bereich hilfreich. Sie sollten verstehen, auf welche Fragen Sie Antworten liefern müssen – und eine Strategie haben, wie Sie diese bekommen. Dazu ist es zunächst einmal wichtig, sich ein Bild über den aktuellen Status Quo zu machen. Blicken Sie genau auf Ihre eigene Wertschöpfungskette:
- Wie hoch sind meine direkten und indirekten CO2-Emissionen und wo gibt es Ansatzpunkte, diese zu reduzieren?
- Wie ist meine Kundschaft vom Klimawandel betroffen und welche Auswirkungen hat das auf die Nachfrage nach unseren Produkten?
- Wie anfällig sind unsere Zulieferer und Lieferwege gegenüber physischen und transitorischen Risiken?
- Wie gefährdet sind unsere Standorte hinsichtlich der Folgen des Klimawandels, z.B. bei häufigeren Überschwemmungen oder bei Dürre.
Die Informationen, die Sie für Ihren Bericht brauchen, gehen in die Tiefe. Je nach Industriesektor und Position inder Wertschöpfungskette ergeben sich aus dieser Analyse Chancen und Risiken, die sich durch steigende Energie-, Rohstoff-, Transport – oder Reputationsrisiken äußern. Hier machen Sie transparent, wie Ihr Unternehmen auf die analysierten Chancen und Risiken reagiert und welche Mitigationsmaßnahmen Sie daraus ableiten.
3. Das Rating
Schritt drei ist das Nachhaltigkeitsrating durch eine Ratingagentur. Insbesondere für Unternehmen, die auch am Kapitalmarkt tätig werden wollen, ist das ein Muss. Dazu – sowie zu Themen wie Fördermitteln, Klimarisikoanalysen oder ESG-Finanzierungen – beraten wir Sie gerne .
Greenwashing vermeiden: Authentische Nachhaltigkeit im Unternehmen
Nachhaltigkeitsstrategie und Nachhaltigkeitsbericht sind gute Instrumente, um offen über Themen wie den CO2-Fußabdruck zu sprechen. Und natürlich können Unternehmen auch getrost nach außen kommunizieren, wie viel nachhaltiger sie inzwischen sind. Nur eine Gefahr steht ihnen dabei im Weg: Der Vorwurf: „Ihr betreibt ja bloß Greenwashing”. Greenwashing meint, dass sich Unternehmen umweltbewusster und umweltfreundlicher darstellen, als sie es tatsächlich sind. Mal verdient und mal unverdient trifft dies immer wieder Unternehmen. Zum Beispiel, wenn sie sich im Marketing plötzlich von einer ganz besonders grünen Seite zeigen – aber keine Beweise für die Nachhaltigkeit präsentieren können.“
Was bedeutet ESG für die Immobilienwirtschaft?
Begriffe wie Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und soziale Unternehmensführung sind nicht erst seit gestern von Bedeutung in der Immobilienbranche. Mit der Abkürzung ESG hat sich nun schon länger ein Begriff etabliert, der das Wirken und Handeln aller, die mit Immobilienentwicklung, Beratung und Kauf zu tun haben, stark beeinflusst. Was bedeutet das im Einzelnen? Welche Aspekte und Themen sind dabei von Bedeutung? Und welche Auswirkung haben die drei Buchstaben etwa auf Investoren, Bestandshalter und Asset Manager?
Dass E für Environmental, S für Social und G für Governance (deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) steht, werden die meisten wissen. Doch was das im Einzelnen vor allem für die Immobilienbranche bedeutet, ist nicht unter einer einheitlichen Definition zu fassen. Bis März letzten Jahres war es zudem jedem Unternehmen selbst überlassen, was es für sich daraus zieht und umsetzt. Deutschlandweite und europäische Standards sind nun allerdings mit dem EU Sustainable Finance Action Plan und der Taxonomie und Offenlegungs-Verordnung verbindlich festgehalten. Wie also wird eine Immobilie grün und nachhaltig bzw. wie handle ich ESG-konform?
E wie Environment – ökologische Verantwortung
Der Begriff Environmental bezieht sich im weitesten Sinne auf alles, was die Umwelt betrifft. Auf den Immobilienbereich angewendet, geht es hierbei vor allem um die Klimaneutralität von Gebäuden. Gerade im Hinblick darauf, dass 35% des gesamten deutschen Endenergieverbrauchs auf Gebäude fallen, ist dieser Aspekt von zentraler Bedeutung. Mit dem Ziel vor Augen, sämtliche Gebäude in Europa bis 2050 klimaneutral zu gestalten (Stichwort Fit for 55), geht es also beim Buchstaben E um CO2-reduziertes und ressourcenschonendes Bauen, die Verwendung von erneuerbaren Energien, dem Materialeinsatz im Sinne der Kreislaufwirtschaft sowie um die Minimierung des Wasserverbrauchs und die Reduktion der Müllmenge.
S wie Social – soziale Verantwortung
Beim Schlagwort soziale Verantwortung denkt man an Themen wie Gerechtigkeit, Zugang zu Bildung für alle, equal pay, Einhaltung von ethischen Standards. Übersetzt auf die Immobilienbranche lassen sich zentrale Punkte festhalten: bei der Auswahl von Gewerbemietern kann ich darauf achten, dass diese nachhaltige Geschäftsmodelle verfolgen. Ethisch bedenkliche Unternehmen, die etwa mit Waffenhandel, Kinderarbeit, Lohndumping oder der Ausbeutung natürlicher Ressourcen in Verbindung stehen, bekommen keinen Mietvertrag. Zudem sollten Mieter angehalten werden, für angemessene und gesunde Arbeitsplätze zu sorgen.
Auch von Interesse: Ist es ihm zum Beispiel wichtig, Fahrrad- anstatt Autoparkplätze anzubieten oder fragt er nach Ladestationen für E-Autos? Bereits vor der Vermietung kann ich Einblick nehmen in Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte, um mich über ökologische und ethische Standards des potenziellen Mieters oder Käufers zu informieren. Weitere „S-Punkte“: Mietpreisgedämpfter Wohnraum für Kitas, soziale und kulturelle Projekte, finanzielle und räumliche Unterstützung von sozialen und lokalen Projekten.
G wie Governance – Unternehmensführung
Während sich der Bereich S also auf das bezieht, was innerhalb der Immobilie geschieht, bezieht sich das G auf das „Außerhalb“. Im weitesten Sinne geht es hierbei um Unternehmensführung von Investoren, Immobilienunternehmen und Bauprojektentwicklern. Auch wenn etwa bei einer Projektentwicklung jedes der Ziele individuell auf die jeweilige Immobilie oder den Standort angepasst werden muss, lassen sich Grundsätze konstatieren, die als allgemeingültig für den Bereich Governance gelten können.
Neben der transparenten Kommunikation gegenüber Anlegern, Investoren und staatlichen Organen gehört dazu das offene Reporting von Planung und Entwicklung. Plane ich ein Projekt, das etwa zur Quartiersentwicklung entscheidend beiträgt, sollte Nachbarschaft und Zivilgesellschaft von Anfang an partizipativ einbezogen werden. Es gilt dabei unterschiedliche Interessen zu berücksichtigen. Auch die Beachtung der Bereiche Risiko- und Reputationsmanagement, Aufsichtsstrukturen, Compliance und Korruption gehören zum G dazu.
ESG für Makler
Für die beratende Tätigkeit des Maklers bedeutet ESG, dass er etwa bei der Bewertung von Immobilien deren technische Nachhaltigkeit berücksichtigt. Beispielsweise bei der Auswahl von Käufern und Mieterbesatz betrachtet er, wie sich diese zum Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz und ethischen Fragen positionieren. Damit zusammenhängend kann er auch zum Thema grüner Mietvertrag informieren und beraten. Damit ein Makler in Sachen ESG zum Profi wird, bedarf es nicht nur der regelmäßigen Auseinandersetzung mit Regeln und Rahmenbedingungen, sondern auch der stetigen, professionellen Weiterbildung.
ESG für Investoren
Private Bestandshalter und Investoren haben durch die Taxonomie auf der einen Seite ein relevantes Klassifizierungssystem für die Bewertung der ökologischen Nachhaltigkeit an die Hand bekommen. Auf der anderen Seite müssen sie sich mehr denn je Fragen nach dem Sanierungszwang ihres Bestandes stellen und genau hinschauen, was die EU-Gebäuderichtlinie (EPBD = englisch: Energy performance of buildings directive) etwa für den Umgang mit schlechten Energieeffizienzklassen festlegt. Was aber bedeuten Taxonomie- und Offenlegungs-Verordnung für Investoren im Speziellen?
EU-Taxonomie- und EU-Offenlegungs-Verordnung
Die EU-Taxonomie Verordnung ist ein Kriterienkatalog und betrifft fast alle größeren Asset Manager und Investoren. Sie definiert nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten durch die Bestimmung von EU-Kriterien und lenkt Kapitalströme in das, was als nachhaltig bezeichnet wird. Durch die EU-Offenlegungs Verordnung werden Immobilienfonds gemäß drei Artikeln klassifiziert (Art.6: ohne ESG-Besonderheiten, Art. 8: mit ESG-Merkmalen, Art.9: mit Nachhaltigkeitszielen).
Das heißt, sie definiert Kennzahlen, die messbar machen, wie ein Fonds investiert hat und gibt so klare Kategorien vor, an der sich ein Anleger orientieren kann. Auch Banken, Verkäufer und Projektentwickler können sich durch die Verordnung die Fragen beantworten, wieviel Prozent eines Fondsvermögens nachhaltig und welche Umweltziele erreicht sind. Durch die Finanzmarktrichtlinie MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive), die ab Sommer 2022 die Nachhaltigkeitspräferenzen abfragen wird, weiß man, mit welcher Präferenz Anleger investieren und hält sie so in Sachen Nachhaltigkeit zur Transparenz an.
Für private Eigentümer werden die erläuterten Verordnungen und Kriterien relevant, wenn sie sich Gedanken über den zukünftigen Weiterverkauf ihres Objektes machen. Da steht vor allem im Vordergrund: Ist die Immobilie oder ein ganzer Bestand noch fondstauglich, wenn ich mich nach den neuen Kriterien richte? Denn fällt der Verkauf durch einen Fonds flach, hat das natürlich Auswirkungen auf den Preis.
Sie möchten wissen, was die ESG-Prinzipien für Ihr Investment bedeuten und worauf Sie achten sollten? Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gern umfassend zum Thema.
Ingenieurbüro Wurm GmbH & Co. KG
Hauptstraße 8
84550 Feichten an der Alz
Tel.: +49 8623 / 6132 410 oder
Tel.: +49 8623 / 6132 411
E-Mail: thomas.wurm@bauplanung-wurm.de